„Und guck ja bloß nie nach vorne, zum Kirchturm in Romanshorn. Immer nur schön nach links und rechts blicken, ok?" Ein etwas seltsamer Ratschlag, wie ich finde, dann hopse ich ins Wasser an diesem strahlenden Prachttag im Juli, hinein in den Bodensee, und schwimme zum Startpunkt. Der ist leicht auszumachen: Ein Strand mit einer Handvoll Journalisten, die darauf warten, dass ich ihnen Interviews gebe. Temperaturcheck: Kalt ist das Wasser nicht, aber warm geht auch anders. Spiddelige Strünke reichen vom Grund hinauf ins besonnte Türkis; ich kenne diese Wasserpflanzen aus dem Fühlinger See in Köln und bin wieder nicht dazugekommen, nachzuschauen, um welche Art es sich handelt.
Prost Mahlzeit, zische ich beim Eintauchen, noch vor dem ersten Meter gescheitert. Alles für die Katz. Und dabei will ich ja nur rüber, rechne mit einer Schwimmzeit von fünf Stunden – und werde aus Schwimmerkreisen hierfür eher belächelt. „Fünf Stunden? Ah, Du willst Brust schwimmen!" – „Nein, Kraul" Hm, soso.

Etwas kurz angebunden begrüße ich die Runde und pule mir die Silikonstöpsel aus den Ohren, um hörtauglich zu sein. Erster kleiner Fehler, denn nachdem ich in ein paar Radiomikros gegrüßt habe, erklingt die Bootssirene, ich verabschiede mich eilig, stopfe die Stöpsel wieder in die Gehörgänge und zurre die Badehaube zurecht. Dabei touchiere ich den aus Kälteschutzgründen mit Vaseline eingecremten Rücken, und wie jeder Langstreckenschwimmer weiß, sorgt Creme an den Fingern für den sofortigen und endgültigen Verlust des Wassergefühls. So habe ich jedenfalls in diversen Fachbüchern gelesen.

Egal, ich schwimme die ersten paar Meter kochend vor Wut, das erhöht schon mal ordentlich die Temperatur, ich heize los wie Mark Spitz, eile zum Boot, das 50 Meter vor dem Ufer auf mich wartet (Näher ran ging nicht, weil sich die Wasserpflanzen sonst um die Schraube wickeln, und dann gäb’s Strunksuppe mit Kolbenfresser). Fluchend lasse ich mir von Observant Oliver ein Handtuch reichen, frottiere mir die Finger und hetze auf und davon, um den frottierbedingten Zeitverlust wieder reinzuholen. Also „hetzen" nach meinen Möglichkeiten. Im Schwimmbad brauche ich für 3km etwa eine Stunde zehn, ohne viel Anstrengung. Und so fange ich umgehend an zu rechnen: Wenn ich jetzt richtig reinhaue, schaffe ich 3km in einer Stunde, bin also in vier Stunden drüben. Und mit diesem, wie ich bald lerne, völlig lachhaften, eben nur eines schwimmenden Grünschnabels würdigen Ansatz kämpfe ich mich durch den See.

Perfekte Bedingungen: Sonne lacht, das Wasser ist ruhig, nur die Wassertemperatur wirft gewisse Fragen auf. Etwas über zwanzig Grad, also für echte Langstreckenschwimmer „warm". Ich aber bin ja eher so eine Art Landratte, habe mich zur Bodenseequerung nur entschlossen, nachdem Sportfreund Carsten und ich beim Haarer 24-Stunden-Schwimmen im Dezember so viel Spaß hatten. Wiewohl ich seit Ostern viel in Fluss und Tümpel trainiert habe, bin ich weiterhin nicht völlig kältefest; es gibt Tage, da fröstele ich schnell, vor allem nach wenig Schlaf – etwa in einem fremden Hotelbett. Hättste mal zuhause geschlafen, murmele ich ins Wasser hinein. Egal. Wer schneller schwimmt, hat früher Feierabend, also: Vorwärts! Wasser marsch!
Nach einer halben Stunde erste Verpflegungspause. „Super, du liegst genau im Zeitplan" nickt Oliver, dann nehme ich einen Schluck aus der Pulle, beschließe jedoch, zukünftig das Seewasser zu trinken, einfach aus Bequemlichkeitsgründen, und vielleicht lassen sich so noch ein paar Sekunden einsparen, hihi. Das Wasser schmeckt prima; es fühlt sich seidig an und schimmert betörend. Zwar kann man auch einige Meter weit sehen, aber das lohnt kaum. Keine Fische, auch keine Taucher, keine Quallen, kein gar nichts. Nada, niente. Nur Türkis, und die mit der Zughand ins Wasser einge- schlagenen Luftbläschen.
Alle paar Hundert Meter ändert sich die Temperatur. Mal durchschwimmt man ausgesprochen warme Bereiche, und dann, ganz plötzlich, wird man von schneidiger Kälte umarmt. Der Gegenwind sauge Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche, erklärt Oliver beim nächsten Stopp und überreicht mir ein Kohlehydratgel. Eigentlich mag ich diese Tütchen gar nicht, aber hier im Wasser, so hatte ich mir ausgemalt, sind Gele und Bananen am leichtesten zu verzehren. Laut Reglement darf das Boot nicht berührt werden, und so lasse ich mir alles anreichen. Der Gegenwind, so Oliver weiter, sorge allerdings auch für eine deutliche Gegenströmung, die mein Tempo reduziere. Hm. Einstweilen egal, ich merk‘s ja nicht. Der Romanshorner Kirchturm ist bisher höchstens schemenhaft zu erkennen, jedenfalls aus der Fischperspektive. Einfach weiterschwimmen. Leichte Krampfneigung, Oberschenkel rechts, hinten. Nur nicht zu viel drüber nachdenken.

33 Züge Kraul, so zählt Oliver mit, konstant. Dreieratmung. Schaue ich nach links, zum Begleitboot, blicke ich in auffallend sorgenvolle Mienen. Stimmt irgendwas nicht? Ok, ich mag ein wenig langsamer geworden sein, aber müssen die denn soo düster dreinblicken? Ich friere ein wenig, und auf meinen Armen vermerke ich eine ausgewachsene Gänsehaut. Beim nächsten Stopp schlägt Oliver vor, dass wir von der stündlichen auf halbstündliche Verpflegung umstellen. Au weia. Ich muss einen schlechten Eindruck machen. Ich stimme etwas kleinlaut zu und hebe immer wieder energisch den Daumen, als die Crew mich fragt, ob denn alles in Ordnung sei – und das fragt sie verdächtig oft. Ihr merkt doch, wenn ich absaufe, brummele ich verstohlen und drücke aufs Gaspedal. Aber da ist keins, sondern nur Wasser. Es folgt eine verhältnismäßig angenehme Periode der Ereignislosigkeit, nur unterbrochen durch Gele und Bananen. Nebenan aalt sich die Crew, ich kraule parallel, jetzt mit etwas größerem Abstand.
Nicht denken, einfach schwimmen. Vorher wage ich allerdings doch mal einen Blick nach vorne: Da ist er, der Romanshorner Kirchturm. Noch recht fern, aber gleichzeitig verlockend nah. Ganz klar zeichnet sich seine schwarze Silhouette vom Himmel ab. Vergleichsweise ein Blick in die andere Richtung: Ach du Scheiße –Friedrichshafen ist ja immer noch viel näher! Ich suche sogleich nach Argumenten, die meinen Frust lindern. Die Sonne bescheine Friedrichshafen, und darum seien alle Details besser ausgeleuchtet. Außerdem sei Friedrichshafen ja die viel größere Stadt, mit den größeren Gebäuden – die müsse ja zwangsläufig größer und somit näher aussehen, ganz egal, wie weit man entfernt ist.
Schließlich lächelt mir Oliver zu: Jetzt sind’s nur noch 5,5. „Das ist ja eine Strecke, die Du aus dem Training kennst". Einerseits freue ich mich, hurra, ja, kenne ich, andererseits frage ich etwas misstrauisch: Und wieviel haben wir jetzt? Sechs? „Nein, vielleicht etwa fünf". Wie? Ich denk, das sind insgesamt 12 km? Dann müsste ich doch mehr als die Hälfte haben, oder? Enttäuschung de luxe. Ein Blick auf die Uhr. Blöd, dass ich beim Start nicht draufgeschaut habe. Muss etwa viertel nach elf gewesen sein. Jetzt ist es...ach, egal.

Schluss damit. Zeit für ein bisschen Schwimmen. Konzentriere Dich auf die Technik, das hilft dir am meisten. Artig die Beine zusammen lassen, am besten so, dass sich die großen Zehen bei jedem Schlag berühren. Ich versuche, „schön" zu schwimmen, aber der Nachteil der Introspektion besteht darin, dass gewisse Malaisen umso deutlicher wahrgenommen werden: Weiterhin ist da diese blöde Krampfneigung; kann wohl mit dem kalten Wasser zu tun haben, oder habe ich auf dem ersten Kilometer zu viel Druck gemacht? Außerdem muss ich weiterhin frieren, jedenfalls beim Durchschwimmen kalter Zonen, was ja nun auch kein echtes Wunder ist, hihi, das ist ja das Wesen der Kälte, dass man in ihr friert.
Klar: Man kann sich natürlich einen Neoprenanzug anziehen, aber dann, so markiere ich den Kernigen, könne man ja auch gleich mit der Fähre fahren. Ein richtiger Langstreckenschwimmer trägt eine Bade- hose. Oder einen Badeanzug, wie die von mir so hochverehrte Gertrude Ederle.
Und noch eine Malaise macht mich etwas missmutig: Ich fühle mich schlapper, habe hier im Wasser aber keinen richtigen Appetit – jedenfalls nicht auf Banane und Gels. Ein schöner Schweinebraten, ordentlich salzig- das wäre was. Den gibt’s hier aber nicht, ließe sich schwimmend auch nur schwer verzehren. (Ein aufblasbarer Schwimmtisch! Komplett eingedeckt! Dringend erfinden!).
Alle halbe Stunde stopfe ich mir also weiterhin eine halbe Banane in den Mund und brüstele ein paar Züge, solange, bis ich den Klumpen hinabgewürgt habe. Mittlerweile passiert es allerdings immer häufiger, dass die Banane schwuppdiwupp wieder rauskommt, besonders dann, wenn ich unfreiwillig einen besonders großen Humpen Seewasser verschlucke – und das kommt vor. Vor allem, wenn wir von der Autofähre überholt werden, die mich mit Wellengang verwöhnt. Auf der Fähre stehen Schaulustige, von denen man mir später berichten wird, sie hätten gejubelt und angefeuert – vorerst kriege ich hiervon allerdings nichts mit, wegen der Ohrenstöpsel.


Blick zum Kirchturm. Nein, kann gar nicht sein. Der war doch vor einer Stunde exakt genauso groß wie jetzt, oder nicht? Ich will melancholisch seufzen, aber just in dem Moment sprudelt wieder mal mein Mageninhalt empor, und Seufzen ist nicht. Klappe halten, weiterschwimmen. Ist ja alles freiwillig. Freiwillig? Ich grüble schwimmend über Wille, Wasser, Freiheit, eingebildete Freiheit, Zwänge, denen man sich selber unterwirft, Journalisten am Ufer, Bananenkotze, die sorgenvollen Blicke der Begleiter, und immer mehr unverdauliche Zutaten mischen sich in den Gedankeneintopf: Wie konnte ich zu diesem verschlagenen Egomanen werden, zu diesem kriselnden Gernegroß, schluchz, zu diesem mickrigen Besserwisser mit schütterem Haar, bibber, bald ist alles vorbei, aua, es krampft, ist da vielleicht irgendwo ein Fisch? Nein, nur ein Mikropartikel in meiner Tränenflüssigkeit. Luftblasen. Vom Grund? Von mir? Je kälter das Wasser, desto mehr Harndrang. Schade, dass ich schwimmend so schlecht pinkeln kann. Geht nur mit Totermann. Und die Crew ist bestimmt jetzt schon genervt, bei meinem Wasserschneckentempo. Also weiter. Schnatter. Was mache ich hier? Ich will auch in so’n Boot.
Mit sieben bei Herrn Steigerwald Schwimmen ge- lernt. Immer habe ich damals gefroren. Ich wog 20 Kilo, eine halbe Stunde im alten Oldenburger Hal- lenbad, und ich zitterte stundenlang. Und warum jetzt wieder frieren, vier Jahrzehnte später? Lernst Du gar nichts dazu, Boning? Bissu doof? Kümmere Dich mal um die wichtigen Sachen! Zuhause sind Steuerunterlagen, die müssen sortiert werden! Theatertext lernen! Grrrrr, Scheibenkleister, es krampft schon wieder, jetzt in beiden Beinen. Nicht bewegen. Schön die Arme arbeiten lassen. Ruhe dahinten. Wie zwei Besenstiele schleppe ich die Beine durchs Wasser.

Blick zum Kirchtum. FUCK, warum sieht der immer noch genauso klein aus? Ist doch bestimmt wieder eine Stunde rum? Warum wird der nicht größer? Ein schönes Gewitter, das wär’s. Dann bestünde Blitzgefahr und man dürfte sofort raus. Links und rechts Wolkentürme. Überm Pfänder, bei Bregenz, sogar leicht gewitterförmig. Blick nach hinten: Friedrichshafen auch quellwolkig. Huch, ist Friedrichshafen noch groß. Immer noch irgendwie größer als Romanshorn. Über uns: Märchenhaft blauer Himmel. Hui, ist das Wasser hier kalt. Geis- terbahneffekt: Hallo, ich bin’s, das Kältemonster aus der Tiefe! Krampf. Kotz. Kirchturmblick. Aha. Jetzt kann ich Bäume unterscheiden. Da tut sich was!
Stundenlang geht das so. Immer dicker und düsterer wird der Eintopf, der da innerlich vor sich hin köchelt. Aber, merkwürdig: Über eine Aufgabe denke ich nie nach. Vielleicht, weil’s das erste Mal ist. Da ist immerhin der Reiz des neuen. Alles neue Krisen. Das Kirchturmproblem kenne ich vom Laufen und Radfahren nur in Ansätzen, etwa bei der schnurgeraden Straße, die durch den Perlacher Forst aus München herausführt. Aber die hat man nach einer Viertelstunde hinter sich. Oder die langen Geraden beim Bienwaldmarathon in Kandel – verglichen mit einer Geraden auf See natürlich pillepalle.
Insofern ist dies eine echte Bereicherung des Er- fahrungsschatzes, die ich zu genießen versuche. Und das klappt, auf der Empore über der Eintopfebene, recht gut.

So. Irgendwann, Stunden später, stopfe ich mir eine weitere Banane in den Mund und höre durch die Silikonstöpsel: „Noch ein Kilometer!" Yeah, das tut gut! Wir passieren ein paar Segel- und Fischerboote, mal wieder verkrampfte Besenstiele hinter mir herziehend, nehme noch ein Schlückchen Cola, ich mache unter dem Kirchturm Yachten aus und entstöpsele meine Ohren, um mich nun, da ich sicher weiß, das Ufer zu erreichen, a bisserl durch die Gespräche der Crew unterhalten zu können. Oliver schwimmt mal wieder neben mir und versucht seinen Freunden zu erklären, wo genau sich jene Treppe befindet, an der ich Land betreten soll. Schwierig zu erkennen. „Jetzt sind’s noch achthundert Meter" sagt der Skipper, und ich re- agiere nachgerade panisch. „WAAAS? Eben war’s doch nur ein Kilometer, und das ist doch ewig her!" Er zuckt mit den Schultern, der Gute. Tja, mal wieder etwas abgetrieben. Ist uns strömungsbedingt heute ein paar Mal passiert, so dass die Strecke am Ende 12,7 km beträgt.
Seezeichen 24, nur noch wenige 100 Meter
Schließlich überstürzen sich die Ereignisse: Gar- tenabfälle im Wasser! Ein Hinweisschild für Boote, auf dem „24" steht! Ich schalte um auf Omabrust, damit ich alles ganz genau wahrnehmen kann - immerhin liegen nun die schönsten Augenblicke meiner noch jungen Schwimmerkarriere vor mir. Schon sehe ich badende Jugendliche vor der Treppe an der Hafenmauer. Eine Frau sitzt auf einer Stufe und sonnt sich. Neben ihr ein... Moment... ein Kajak. Dahinter parkende Autos. Lancia. Fiat. Und dann, tatatata, tauche ich unter, um den Boden zu inspizieren, richte mich auf in die Vertikale, genieße den Kies unter meinen Füssen, erinnere mich, dass Oliver mich am Morgen vor der Rutschgefahr auf eben dieser Treppe gewarnt hatte, klettere vorsichtig über ein paar Felsen, sitze auf der Treppe, stelle mich in äußerster Zeitlupe reglementgerecht auf, so dass die Zeitnahme beendet werden kann. Piep.


Unfassbar. Sieben Stunden vierundzwanzig Minuten. Ein Rekord für die Ewigkeit. So langsam ist in der Geschichte der offiziellen Bodenseequerung noch nie jemand über den See geschwommen. Klingt jetzt etwas albern, aber dies ist ein Rekord, auf den ich ziemlich stolz bin, ganz im Ernst. Ich bin ja in Wirklichkeit gar kein Schwimmer. Aber Weltmeister.
Merke: Das tun, was man eh kann, kann ja jeder. Interessant wird‘s, wenn man sich an etwas versucht, was man - eigentlich - NICHT kann.
Schön, die warme Abendsonne auf der zittrigen Haut. Ein Interview für eine wartende Journalistin, dann zurück zum Boot schwimmen, abtrocknen, rüberheizen. Danke. Vor allem an Oliver und seine Supercrew. Aber auch an Poseidon. Und Dich, liebe Leserin, lieber Leser.
17. Juli 2014































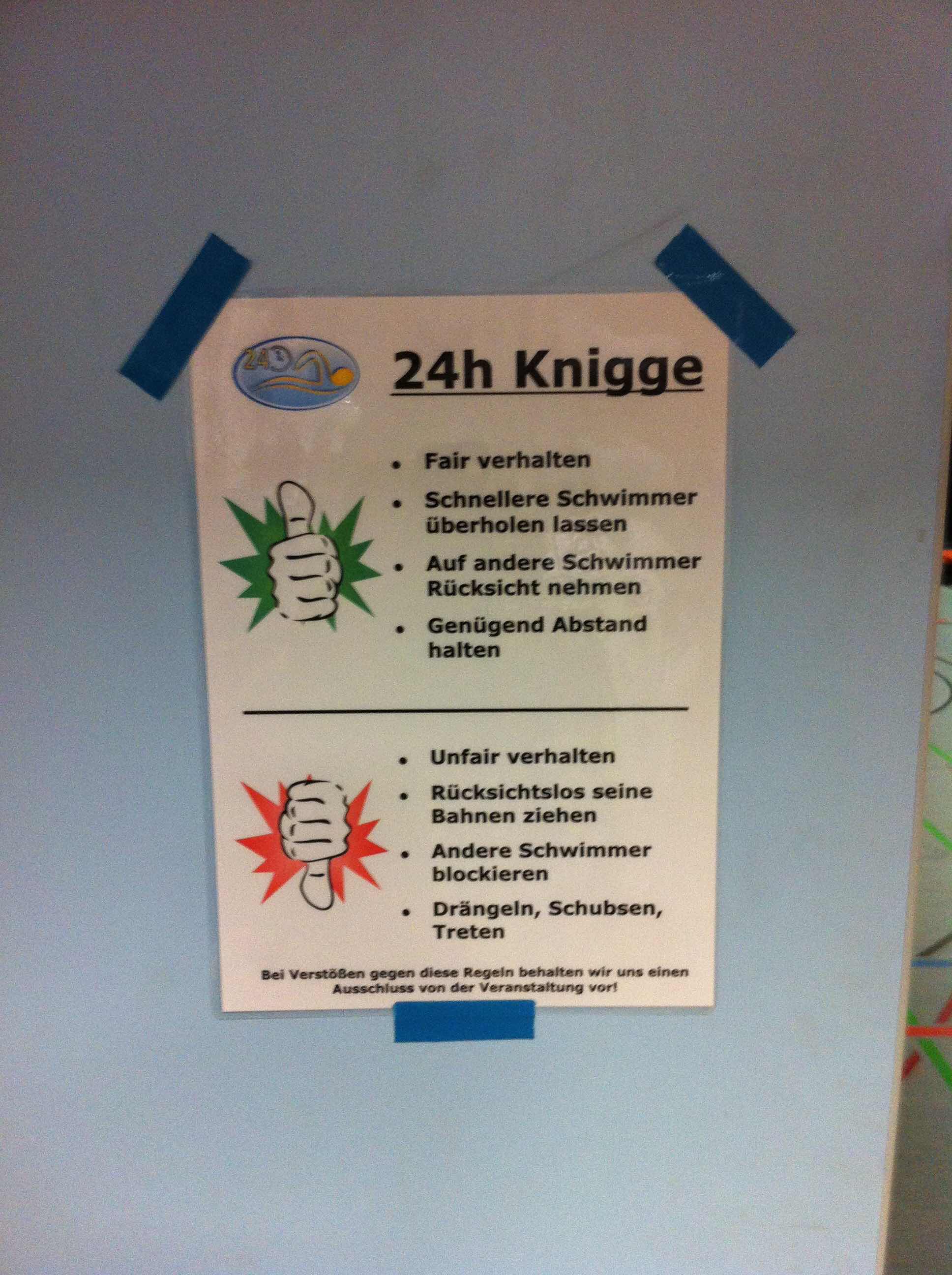
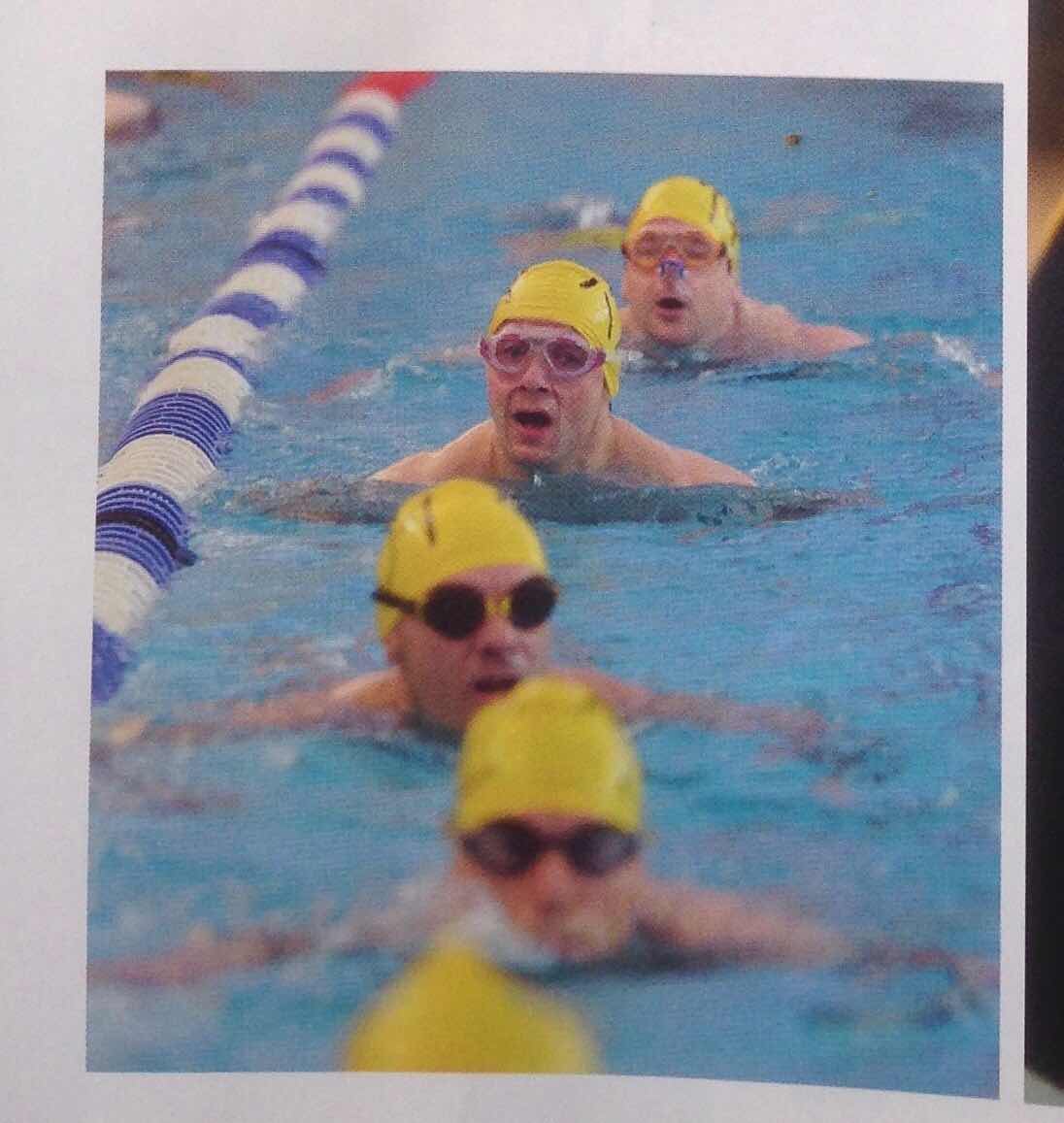












 Unser
Unser 



